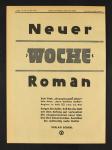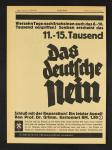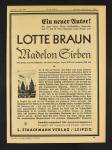Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : 21.05.1932
- Strukturtyp
- Ausgabe
- Band
- 1932-05-21
- Erscheinungsdatum
- 21.05.1932
- Sprache
- Deutsch
- Sammlungen
- LDP: Zeitungen
- Zeitungen
- Saxonica
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- PURL
- http://digital.slub-dresden.de/id39946221X-19320521
- URN
- urn:nbn:de:bsz:14-db-id39946221X-193205215
- OAI-Identifier
- oai:de:slub-dresden:db:id-39946221X-19320521
- Nutzungshinweis
- Freier Zugang - Rechte vorbehalten 1.0
- Lizenz-/Rechtehinweis
- Urheberrechtsschutz 1.0
Inhaltsverzeichnis
- ZeitungBörsenblatt für den deutschen Buchhandel
- Jahr1932
- Monat1932-05
- Tag1932-05-21
- Monat1932-05
- Jahr1932
-
-
-
-
-
413
-
414
-
415
-
416
-
2405
-
2406
-
2407
-
2408
-
2409
-
2410
-
2411
-
2412
-
2413
-
2414
-
2415
-
2416
-
2417
-
2418
-
2419
-
2420
-
417
-
418
-
419
-
420
-
-
-
-
- Links
-
Downloads
- PDF herunterladen
- Einzelseite als Bild herunterladen (JPG)
-
Volltext Seite (XML)
X« 116, 21. Mai 1932. Redaktioneller Teil. Börsenblatt f. b.Dtschu Buchhandel. Goethe und seine Wett. Die Ausstellung der Sammlung Kippcnbcrg in Berlin. Die Reichshanptstadt wäre, bei den verhältnismäßig unwichtigen Beziehungen Goethes zu Berlin, nicht in der Lage gewesen, im Goethe-Jahr eine Erinnerungsstätte von Bedeutung aus eigenen Dokumenten zu schaffen. Indem es aber gelang, die wesentlichsten Teile der Sammlung Kippenberg in den zwölf Sälen der Preußi schen Akademie der Künste anszubreiten, erhielt Berlin eine Aus stellung, die nicht allein nach Inhalt und Umfang gleichwertig neben den berühmten Goethestätten in Weimar und Frankfurt steht, sondern uns Menscher, von heute darum besonders anspricht und innerlichst berührt, weil sie die schöpferische Leistung eines heute lebenden Men schen ist. Es ist ein seltenes, darum doppelt schönes und wertvolles Erlebnis, zu sehen, wie Liebe und Verehrung, von umfassender Kenntnis gefördert, vom Sammlerglttck begünstigt, die Totalität einer menschlichen Existenz erfaßbar gemacht haben. »Einen Einzigen ver ehren«: unter diesem Leitwort hat Anton Kippenberg die Dokumente von Goethes Dasein, seiner geistigen Welt und irdischen Umwelt ge sammelt und zum großartigen Ensemble des bedeutendsten deutschen Menschenlebens vereinigt. Die Ausstellung dieser Sammlung ist aber nun nicht allein um ihres Inhaltes und des in ihr waltenden Geistes hoher Verehrung sehenswert, sondern auch als Ausstellung, in der Aufteilung und Gliederung, von der Disposition der zwölf Räume bis zum Aufbau der einzelnen Vitrine. Sehe man beispielsweise die Vitrine »Eckcr- mann«: Im Mittelpunkt finden sich Eckermanns Buch »Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung ans Goethe«, das die Ver bindung herstellte, und die gerahmte Visitenkarte Goethes mit seinem handschriftlichen Zusatz »wünscht Hrn. Eckermann um zwölf Uhr bey sich zu scheu«. Um dieses Vorspiel der Bekanntschaft gruppieren sich alle weiteren Dokumente. Mag diese Anordnung im Kleinen als selbstverständlich hinge nommen und kaum so hoch bewertet werden, wie sie es verdient, so muß erst recht ein Wort für die Gesamtanlage gesagt werden, weil auch diese Leistung gar zu leicht über der begreiflichen Freude an den Dokumenten selbst übersehen werden kann. Es scheint mir nämlich in besonders glücklicher Weise eine Gliederung des Ganzen erreicht, die etnM vom Rhythmus des Goetheschen Daseins spüren läßt und den einzelnen Erscheinungen in diesem Dasein durchweg die richtigen Akzente gibt. Zu solchem Eindruck trägt nicht zuletzt die umfassende Ausstellung von Bildern bei. Diese Verwendung bildlicher Dokumente entspricht bem Grundwesen des Augen-Menschen Goethe, sie entspricht aber auch dem Geist der Akademie, in deren Räumen wir uns befinden, und sie trägt schließlich sehr viel >dazu bei, den Besucher, der über Vitrinen allzu leicht ermüdet, immer wieder aus dem Buchstabcnlabyrutth der Handschriften in «die offene Welt eines Menschengesichts, einer weiten Landschaft oder einer farbigen Bühnenphantasie zu leiten. Den Weg durch die Ausstellung weist ein kleiner illustrierter Führer, der aus vollkommenster Kenntnis des Gcsamtbestandes der Sammlung geschaffen ist und daher überall auf die wichtigsten Stücke, aber auch auf die Beziehung des Einzelnen zum Ganzen hinzulenken weiß. Indem ich ihm hier folge, muß ich mich aus einige andeutende Bemerkungen beschränken. Der erste Saal, »Goethestätten«, eröffnet gleichsam nur einen Ausblick in die Welt, die uns erwartet. Neben zeitgenössischen An sichten der wichtigsten Goethestädte werden einige Goethebüsten ge zeigt, darunter die nur in diesem Exemplar vorhandene Terrakotta büste Martin Gottlieb Klauers. Der große Hauptsaal »Goethe« führt vom Eintritt Goethes in den Weimarer Staatsdienst bis zu seinem Tod. Gleich die erste Vitrine enthält die Kostbarkeiten der Handschrift von »Edel sey der Mensch« und das Mondlied in der ersten Fassung von Char- lottens Hand. Von den weiteren Schaukästen hebe ich hervor: Her mann und Dorothea, mit schönen Drucken und Bildern, Schiller und sein Kreis, Romantiker, dann die Dokumente der Verbindung mit Marianne von Willemer und der Liebe zu Ulrike von Levetzow — wie eigenartig berührt da das Stammbnchblatt Ulrikes, das zu unseren Lebzeiten, im Jahre W94, datiert ist! Sehr eindrucksvoll ist, nach schönen Zeugnissen über Goethes weltliterarische Beziehun gen, der Abklang des Lebens, vom letzten Geburtstag an, den Goethe in Ilmenau an Erinnerungsstätten früher Mannesjahre verlebte, bis zum Tod. Hier sieht man auch, auf winzigem Kärtchen, die erste Niederschrift des Gedichts »Die Nachtigall, sie war entfernt«, das in Mendelssohns Vertonung zu den schönsten Goetheliedern gehört und von den Thomanern oft, zuletzt beim Cantate-Festmahl für die Buchhändler gesungen wurde. In der Mitte dieses reich mit Bildern geschmückten Hauptsaales liegen die Erinnerungsstücke an Goethes Tod, Coudrays Niederschrift über seine letzten Tage, Todesanzeigen u. a. m. Durch den Saal »Das Fürstenhaus« mit kostbaren Reliquien mannigfachster Art gelangt man in den zweiten Hauptsaal »Faust«, dessen Betrachtung eine eigene Studie erfordern würde. Alles das, was mit dem Namen und der Gestalt des großen Erzzauberers verbunden ist, steigt hier aus Sage und Geschichte vor unseren Augen empor, und die Zeugnisse der Goetheschen Dichtung selbst finden ihre Krönung in der Handschrift des beschließenden »Olrorus Milieus«. Neben dem Einfluß auf die Literatur wird auch die Beziehung zur bildenden Kunst deutlich, und während sich sonst die Sammlung auf zeitgenössische Arbeiten beschränkt, werden hier auch die Faustbildcr von Künstlern wie Barlach, Jaeckel und Slevogt gezeigt. Durch das kleinere Zimmer »Familie und Vaterstadt« und den wiederum zu längerem Verweilen einladenden Saal Der junge Goethe« kommt man in ein besonders reizvolles Kabinett »Sil houetten«. Diese liebenswürdige Schwarzkunst hat ja in Anton Kip penberg ihren besonderen Kenner, Liebhaber und Geschichtsschreiber gefunden. Sie erlaubt eine sehr anmutige Raumgestaltung, zumal zwei Wandschränke mit Porzellan und der lebensgroße Bacchusknabe von Klauer die Folge der Silhouetten belebend unterbrechen. In eindrucksvollem Kontrast zu diesem Kabinett steht der fol gende Raum »Italien«: hier ist alles groß und weit, farbig und licht. Kunstfreunde werden mit besonderem Vergnügen die 21 Bilder von Giovanni Volpato-Ducros studieren, daneben Aquarelle von Tischbein, Hackert, Stiche von Piranefi, nicht zuletzt aber Handzeich- uungeu Goethes. In dem Saal »Theater und Musik« fesseln den Kenner besonders einige Neuerwerbungen der Sammlung, handschriftliche Anweisungen Goethes über das Heiraten der Schauspieler, über das Extemporieren — Zeugnisse für die lebendige Teilnahme Goethes am Theater. Fast vollständig sieht man hier ferner die zeitgenössischen Kompositionen Goethescher Werke. Gern verweilte ich noch bei der Erinnerung an die letzten Säle: »Naturwissenschaften«, »Wertster«, »Alt-Weimar« aber gerade hier müßte man ins Detail gehen, wollte man den tiefen Eindruck be gründen und eine zureichende Beschreibung bieten. Schließlich sind es ja diese kleinen Einzelstücke, aus denen sich das Ganze aufbaut, und wenn ich den Nachdruck auf die Würdigung des Ganzen, als Lebenswerk und als Ausstellungsleistung, gelegt habe, so se-i darum doch nicht das Elementarste vergessen: der Wert der einzelnen Num mern und Exemplare dieser Handschriften, Bücher, Bilder, die alle ihre Geschichte haben und von denen jedes zu uns spricht, wenn wir den Menschen suchen, dem dieses Werk geweiht ist. Der deutsche Buchhändler, der es mit seiner Aufgabe als Ver walter und Mehrer des Geistes ernst meint, hat allen Anlaß, diese Ausstellung zu besuchen, die aus Ehrfurcht gewachsene, Ehrfurcht ge bietende Leistung eines Buchhändlers. Und in welchem Sinne ein solcher Gang durch die Ausstellung erfolgen soll, hat Anton Kippen berg in der Eröffnungsansprache mit Worten Goethes zum Aus druck gebracht: Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt, Naturgeheimnis werde nachgestammelt. Im Vergänglichen das Ewige zu ehren: das ist die Forderung und der hohe Anspruch, der die schöpferische Tat dieser Ausstellung adelt. Friedrich Ni i ch a e l. Der Leser hat das Wort. Ergebnisse und Lehren eines Preisausschreibens. Bon Professor vr. Johannes Wc r n e r. In seinem letzten Jahresalmanach hat der Verlag L. Staack- mann in Leipzig im Rahmen eines Preisausschreibens eine Um frage an seine Leser gerichtet: »Welches der im Jahre 1931 neu erschienenen (20) Bücher hat Ihnen besonders gefallen und warum?« — Plan und Absicht boi dieser vortrefflichen Idee war, Meinung, Geschmack und Urteil des Publikums unmittelbar kennenzulernen. Die in großer Zahl eingegangenen Antworten, die mir als einem der Preisrichter Vorgelegen haben, gestatten, aus ihnen aus Grund statistischer Beobachtungen in mancherlei Hinsicht Schlüsse zu ziehen, die auch für weitere Kreise des Buchhandels von Interesse sein dürsten. Zunächst die Frage: Wie war die Beteiligung seitens des m ä n n l i ch e n und des w eiblich e n Ges ch l e ch t s ? Das Ergebnis: 74 Prozent aller Antworten kamen von Männern und nur 26 Prozent von Frauen und Mädchen — wirkt überraschend: denn man pflegt doch anzunehmen, daß die Frauenwelt für die »Schöne Literatur« mehr Zeit und Interesse habe als der Mann. Daß weibliche Schüchternheit die Ursache der Zurückhaltung der Frauen sei, wird man heutzutage kaum annehmcn — wenigstens 416
- Aktuelle Seite (TXT)
- METS Datei (XML)
- IIIF Manifest (JSON)
- Doppelseitenansicht
- Keine Volltexte in der Vorschau-Ansicht.
- Einzelseitenansicht
- Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
- Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht